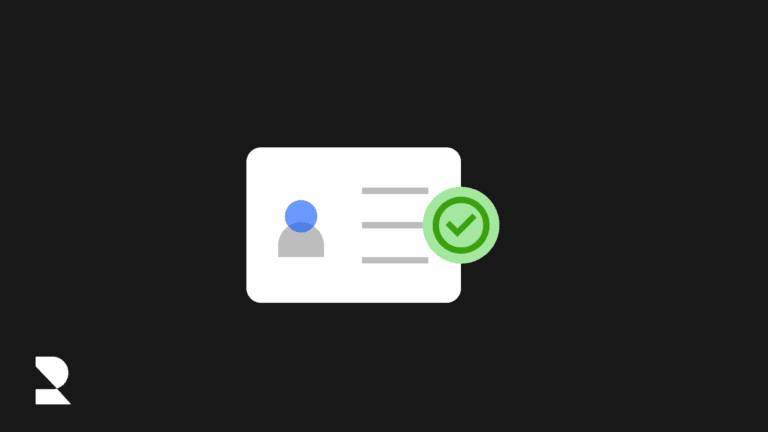Pflicht zur Freigabe nach Drei-Tages-Frist
Mehrere Landgerichte (u. a. Wiesbaden und Frankfurt am Main) haben sich mit der Auslegung des § 46 Abs. 1 Nr. 2 GwG befasst. Ergebnis: Nach Ablauf der dreitägigen Stillhaltefrist ist eine auffällige Transaktion, wegen der eine Verdachtsmeldung abgegeben wurde, grundsätzlich freizugeben, sofern keine Rückmeldung der Behörden erfolgt.
Das LG Wiesbaden verurteilte eine Bank zur Auszahlung eines gesperrten Kontoguthabens – eine über die Frist hinausgehende Kontosperre sei unzulässig. Das LG Frankfurt am Main entschied entsprechend: Auch bei grenzüberschreitenden Überweisungen dürfe ohne behördliche Anordnung keine weitere Blockade erfolgen. Beide Urteile betonen, dass § 46 GwG eine zwingende Freigabepflicht nach Ablauf der Frist vorsieht – ein weiterer Ermessensspielraum für die Verpflichteten bestehe nicht.
Abweichende Verwaltungspraxis und geänderte BaFin AuAs
Die BaFin hingegen vertrat in der Vergangenheit eine andere Ansicht: Verpflichtete sollten nach drei Tagen prüfen, ob ein Festhalten an der Sperre noch geboten erscheint. Diese abweichende Auslegung schaffte erhebliche Unsicherheiten für die Praxis.
Die aktualisierten BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise (AuA AT 2025) versuchen nun eine Brücke zu schlagen, indem sie betonen, dass nach Ablauf der Frist „in der Regel“ die Transaktion freizugeben ist, wenn keine konkreten Verdachtsmomente fortbestehen. Nur, wenn sich ein Verdacht auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nahezu aufdrängt, sollen Verpflichtete die Transaktion weiter anhalten.
Zusätzlich enthält auch die künftige AML-VO (Art. 71 und 72) Vorgaben zur Transaktionsfreigabe: Nach Ablauf der Drei-Tages-Frist muss eine zusätzliche Risikobewertung durch Verpflichtete erfolgen. Wie diese konkret umzusetzen sein wird, ist bislang offen.
Haftungsfreistellung bei Verdachtsmeldungen
Das OLG Frankfurt am Main bestätigte in einem Urteil, dass Verpflichtete nach § 48 GwG grundsätzlich haftungsfrei gestellt sind, wenn sie eine Verdachtsmeldung korrekt erstatten. Nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit entfällt dieser Schutz. Eine fehlerhafte Dokumentation nach § 8 GwG (z. B. unvollständige Begründung zur Abgabe der Meldung) begründet nicht automatisch eine Haftung für Verpflichtete.
Wichtig ist zudem: Verpflichtete sind nicht verpflichtet, vor Abgabe einer Verdachtsmeldung eigene strafrechtliche Ermittlungen vorzunehmen. Entscheidend sind objektive Auffälligkeiten im konkreten Einzelfall.
Fazit
Die Rechtsprechung stellt klar: Nach drei Tagen besteht eine Pflicht zur Freigabe gesperrter Vermögenswerte, sofern keine behördliche Anordnung eingegangen ist. Gleichzeitig bleibt Unsicherheit, da bei einem sich aufdrängenden Verdacht weiterhin eine Anhaltung geboten ist. Für Verpflichtete bedeutet dies, interne Prozesse und Dokumentationsstandards noch stärker abzusichern – insbesondere im Hinblick auf die künftigen Anforderungen der AML-VO.
Hinweis: Für eine detaillierte Analyse vgl. den Aufsatz unserer Expert*innen Markus Haufellner, Dr. Lars Haffke und Emilie Heinrichs in der BKR (Haufellner/Haffke/Heinreichs, “Aktuelle Entwicklungen im Geldwäscherecht“, Zeitschrift für Bank und Kapitalmarktrecht (BKR), 2025, 392)